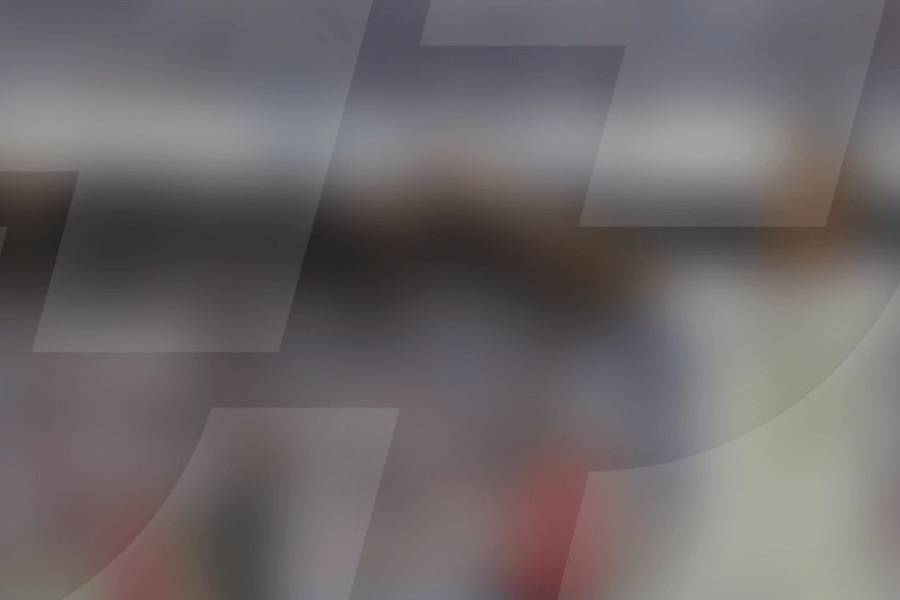Wer auf dem Rastplatz Bornbruch-West auf der A5, südlich der Anschlussstelle Langen-Mörfelden eine Pause einlegt, der muss nur 70 Meter in südliche Richtung auf einem unbefestigten Pfad spazieren, bis er an einen geschichtsträchtigen Ort kommt.
Das kurze Leben einer Motorsport-Ikone
Eine hölzerne Gedenktafel und ein Gedenkstein sind dort an einer Gedenkstätte zu Ehren Bernd Rosemeyers angebracht. Am 28. Januar 1938 war der damals wohl bekannteste deutsche Rennfahrer bei einem Rekordversuch ums Leben gekommen.
Rosemeyer gilt als einer der Pioniere im deutschen Automobilsport – zunächst war der im niedersächsischen Lingen geborene Sohn eines Mechanikermeisters aber auf dem Motorrad unterwegs.

Erste Erfolge, die auch ein gewisses öffentliches Interesse hervorriefen, fuhr Rosemeyer mit einer 1000-cm³-NSU ein, mit der er auf dem Schleizer Dreieck mit 100,034 km/h einen neuen Klassenrekord aufstellte.
Der Wechsel des damals 25-Jährigen zur Auto Union beschleunigte seinen Aufstieg zum deutschen Rennfahr-Idol – und zum Liebling der NS-Führung.
Rosemeyer galt als „Popstar der Nazi-Zeit“
Ob Rosemeyer ein überzeugter Nazi mit entsprechendem Gedankengut war, ist nicht belegt. Experten sind sich allerdings einig, dass er zumindest Mitläufer war, der in die SS vor allem aus Karrieregründen eintrat.
Rennfahrer galten zu dieser Zeit als Sinnbild für Fortschritt und Wagemut, die Auto Union duellierte sich in dieser Zeit mit Mercedes und trieb die Hatz nach Rekorden und Triumphen in immer gefährlichere Dimensionen. Ein gefundenes Fressen für das NS-Regime, das bei allen wichtigen Rennen vor Ort war und Rosemeyer zum Vorzeige-Athleten hochjazzte.
Dass der deutsche Pilot zum ersten „Popstar der Nazi-Zeit“ stilisiert wurde, lag ursächlich an seinem Wechsel vom Motorrad ins Auto, mit dem er in der deutschen Bevölkerung ungeahnte Popularität errang.

Sein Debüt feierte Rosemeyer am 26. Mai 1935 auf der Berliner AVUS, wo er mit der zweitschnellsten Trainingszeit gleich für Furore sorgte, im Rennen aber wegen eines technischen Defektes aufgeben musste.
Den ersten Grand-Prix-Sieg feierte Rosemeyer in Brno in der damaligen Tschechoslowakei. Dort lernte er auch die berühmte deutsche Fliegerin Elly Beinhorn kennen, die er ein Jahr später heiratete. In der folgenden Saison wurde der deutsche Vorzeigesportler überlegener Europameister und gewann sieben von elf Rennen.
Mitte der 1930er-Jahre begann die Jagd nach Geschwindigkeitsrekorden, die Rosemeyer letztlich zum Verhängnis wurde. Als erster Mensch war der Pilot auf der Autobahnstrecke Frankfurt - Darmstadt am 25. Oktober 1937 auf einer öffentlichen Straße schneller als 400 km/h unterwegs.
Rosemeyers Wagemut wird ihm zum Verhängnis
Gut drei Monate später, am 28. Januar 1938, endete das kurze Leben des deutschen Hasardeurs auf derselben Strecke - im Alter von 28 Jahren. Nachdem sein Konkurrent Rudolf Carraciola eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 432,692 km/h (ein Rekord, der bis 2017 hielt!) vorgelegt hatte, wollte Rosemeyer kontern.
Angeblich warnte Carraciola seinen Widersacher noch vor den Windböen, doch dieser setzte sich unbeeindruckt in sein Auto Union Typ R (Rekordwagen), um sich die Bestmarke zurückzuholen.
Das tödliche Unglück ereignete sich hinter der Autobahnauffahrt Langen-Mörfelden in Fahrtrichtung Darmstadt, als das Fahrzeug an einer Waldlichtung wahrscheinlich durch eine Windböe nach links auf die Mittelbegrünung der Autobahn geriet und sich mehrfach überschlug. Rosemeyer wurde aus dem Wagen in den Wald geschleudert - genau an die Stelle, wo heute die Gedenkstätte liegt.
Der Unfall des verwegenen blonden deutschen Rennfahrers schlachtete das NS-Regime aus, indem es die Heldenverehrung auf die Spitze trieb.
„Nach seinem Todessturz steht Bernd Rosemeyer eine Zeitlang fast gleichwertig mit Horst Wessel vor den Augen der Volksfantasie“, schrieb der berühmte Schriftsteller Victor Klemperer.